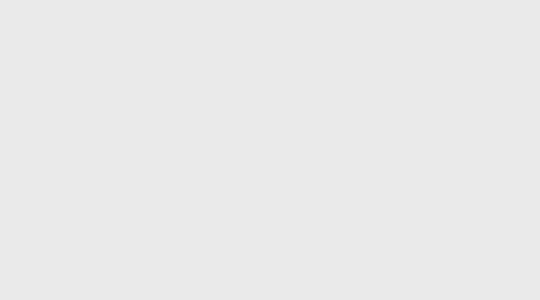stipendiatin
natascha sadr haghighian
Natascha Sadr Haghighian (*1967) arbeitet über soziopolitische Verhältnisse und deren Erscheinungsformen, vor allem auch im Kontext der Kunst und visuellen Kultur. Mit ihren Projekten in sehr unterschiedlichen Formaten ist sie auf internationalen Foren und Ausstellungen vertreten. Sadr Haghighian hat mit dem Reisestipendium der Hessischen Kulturstiftung 2009 einen langen Aufenthalt im Iran finanziert, über den die Künstlerin im folgenden Text berichtet.
Wir möchten Sie darüber hinaus auf die Publikation zu ihrem Forschungsprojekt hinweisen, die vor Kurzem erschienen ist: seeing studies: (Hg.) Natascha Sadr Haghighian & Ashkan Sepahvand; dOCUMENTA (13) in Kooperation mit Casco – Office for Art Design and Theory und dem institute for incongruous translation, Utrecht. Hatje Cantz Verlag, 2011, ISBN 978-3-7757-2972-7.
blau machen
„Aktualität ist, wenn der Leuchtturm dunkel ist zwischen den Lichtblitzen: es ist der Augenblick der Stille zwischen dem Ticken einer Uhr; es ist das leere Intervall, das auf ewig durch die Zeit schlüpft; es ist der Bruch zwischen Vergangenheit und Zukunft: die Nahtstelle des umgebenden Magnetfeldes an den Polen, so unendlich klein und doch existent. Es ist die zwischen dem Zeitlauf liegende Pause, wenn nichts geschieht. Es ist die Leere zwischen den Ereignissen.“
George Kubler, Die Form der Zeit, (1962/dt 1982)Ein Jahr keine Ausstellung. Ein Jahr keine Hotelaufenthalte. Ein Jahr nicht an Orte fahren, wo man nicht tatsächlich hin möchte.
Dies war das Projektvorhaben, mit dem ich mich für das Reisestipendium der Hessischen Kulturstiftung 2009 beworben hatte. Ich habe lange herumgefragt und nach einer Bezeichnung gesucht für dieses Vorhaben, also eine Tätigkeit, die eigentlich keine ist. Der Vorschlag Sabbatical kam von irgendwo, also ein Begriff, der im akademischen Bereich verwendet wird, wenn Lehrende ein Forschungssemester nehmen, um zum Beispiel an einer Publikation zu arbeiten. Diese Form der Auszeit wird bezahlt und ist oft Teil der akademischen Karriere, in der die Zahl der Veröffentlichungen den Status bestimmen. Es geht beim Sabbatical also meist um eine zielorientierte Auszeit oder, wie Wikipedia sagt, ein Arbeitsmodell. Ursprünglich ist das Konzept des sabbaticus oder Shmita ein landwirtschaftliches Gebot der Brache im siebten Jahr. Also sechs Jahre ernten, ein Jahr ruhen lassen. Das hat natürlich auch mit Arbeitsmodellen zu tun und mit Wirtschaftlichkeit. Kein Wunder also, dass darunter heute eine produktive Auszeit und nicht Rumstreunen oder Nichts tun verstanden wird. Ein Bartleby würde wahrscheinlich auch zu einem Sabbatical sagen: „I would prefer not to.“
Ein ähnliches Modell gibt es auch in Firmen. Dort heißt es meist Leave Of Absence oder Auszeit und wird dem berüchtigten Burn-Out-Syndrom vorbeugend und für die Weiterbildung und Umschulung der Arbeitnehmenden eingesetzt . Manchmal wird das bezahlt, manchmal auch nicht. Wenn es nicht bezahlt wird, nennt man es auch carreer break oder gap year. Dass viele der Begriffe englisch sind, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der deregulierte Arbeitsmarkt in den englischsprachigen Ländern schon einige Jahre voraus ist. Das Skurrile an einem career break oder einem gap year ist wohl vor allem das Loch, das sich bildlich als Assoziation aufdrängt. Auch Auszeit hat etwas von einem Lichtschalter, den man umlegt, inklusive der unweigerlich folgenden Dunkelheit. Die Frage ist ja, wo ist man eigentlich, wenn man in einem Aus ist, in einem break oder einem gap?
Man merkt ziemlich schnell, dass die zur Verfügung stehenden Begrifflichkeiten für ein solches Vorhaben eher ernüchternd sind und sich nahtlos einreihen in die Gründe, die das Projekt initial notwendig erscheinen ließen. Wie zum Beispiel die Frage, warum Feste im Volksmund etwas mit Ferien zu tun haben und mit Feiertagen, die einzigen Feiertage in der Kunst jedoch Eröffnungen heißen und Teil der Arbeit sind. Oder das man den Hauptteil seiner Zeit damit verbringt, auf Todeslinien hinzuarbeiten, oft sogar auf mehrere gleichzeitig.
Wo verläuft die Grenze zwischen produktiven und unproduktiven Daseinsmomenten, was ist für wen produktiv und wie rechtfertigen wir das? Georges Bataille schreibt in Der verfemte Teil von einer Ökonomie der Verschwendung, die nicht auf Akkumulation, sondern auf Zirkulation beruht. Er stellt statt Nützlichkeit und Zweck einer Verausgabung die Praktiken des Potlach ins Zentrum einer souveränen Ökonomie. Das Ausüben von Potlach-Praktiken wurde zum Beispiel in Kanada 1885 verboten als ein mehr als nutzloser Brauch, verschwenderisch, unproduktiv und gegenläufig ziviler Werte. Das nahe liegende Problem scheint, dass viele Tätigkeiten heutzutage in einer Grauzone zwischen Konsum, Akkumulation von sozialem Kapital und Teilnahme an technologischen Prozessen herumzirkulieren und nicht eindeutig erkennbar ist, wo die Grenzen zwischen Verschwendung und Produktion, zwischen Facebook und Kaffeetrinken mit Kuratoren verlaufen und wo sich darin eine Auszeit verorten ließe, ohne wahlweise bedrohlich oder absurd zu erscheinen.
Dementsprechend befanden einige Künstler, es wäre mutig ein ganzes Jahr nichts zu machen. Wenn ich dann einwendete, dass ich ja nicht nichts machen wollte, kam ein erleichtertes „Ach so! Also mehr so Recherche und sowas. Aber hast du nicht trotzdem Angst, dass man dich vergisst?“
Das Problem dreht sich an dieser Stelle im Kreis und die unangenehme Frage drängt sich auf: Ist das Bedürfnis, eine Weile keine Kuratoren sehen zu wollen, niemandem erklären zu wollen, was man gerade für ein Projekt macht und wie man gedenkt Sinn herzustellen, keine Katalogbeiträge oder Ausstellungsbeiträge abzuliefern für Bücher und Eröffnungen, die die Welt nicht braucht, also schlicht blau zu machen von der Kunstwelt, ist diese Art von Bedürfnis ähnlich haltlos romantisch und abstrakt wie Natursehnsucht? Also die Sehnsucht nach einem Begehren, in dem man sich aufhalten kann und von dem man selbstverständlich Teil sein möchte, ohne den Ort erst bauen zu müssen.
Nachtrag:
Ich bin seit Kurzem zurück von meinem Jahr blau machen, das heißt zurück im gekerbten Raum der Deadlines und Ausstellungsvorbereitungen. Ich habe viel erlebt und gelernt in diesem Jahr, das sich so schlecht erzählen lässt, jedenfalls nicht in 7000 Zeichen. Ich war die meiste Zeit im Iran. Meinen ursprünglichen Plan, mich in verschiedenen Etappen auch in anderen Ländern aufzuhalten und dort Freunde zu besuchen, hielt ich nur teilweise ein, nachdem im Juni 2009 die manipulierten Präsidentschaftswahlen im Iran zu einer Bürgerrechtsbewegung und auf die Straßen Tehrans führten. Lustigerweise hat keiner meiner iranischen Freunde in dieser Zeit Kunst gemacht oder Filme. Die Produktion stand still, aber das Begehren, in dem man sich aufhalten kann, war plötzlich als tatsächlicher Ort vorhanden. Und das war keineswegs abstrakt oder romantisch. Man konnte es einatmen und darin schwimmen und sogar darin wachsen und es war auch irre anstrengend und beängstigend. Es hat uns alle mit den Gründen in einen Topf geschmissen, warum wir Dinge tun, warum wir formulieren, darstellen, zeigen und zusammenkommen und warum wir immer wieder aus der Kunst einen Ort machen wollen.
Jetzt eineinhalb Jahre später sitze ich wie alle anderen seit Tagen vor dem Computer und schaue atemlos auf die Bilder, die Al Jazeera live aus Kairo überträgt. Die Menschen in Ägypten haben ihre Läden dicht gemacht, ihre Arbeitsplätze verlassen, Ausstellungseröffnungen abgesagt. Die Arbeit ruht, die Uni ist auf der Straße. Sie sind von morgens bis nachts draußen, die Füße müde, die Stimmen heiser. Sie setzen alles aufs Spiel, ohne zu wissen, was kommen wird. Ich hoffe mit allen anderen Freunden, dass dieser Ort des Begehrens nicht mit der gleichen brutalen Gewalt niedergeschlagen wird wie im Iran.